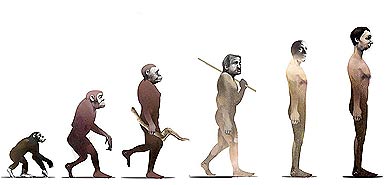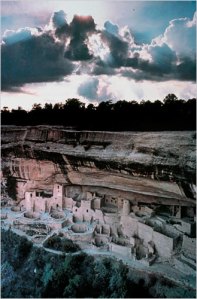Aus der Sorge entspringt die Wirtschaft
Friedrich Bülow, Nationalökonom
Gute
zwei Millionen Jahre lang haben unsere steinzeitlichen Vorfahren in
einem ökologischen Gleichgewicht mit ihrer Umwelt zugebracht. Sie haben
gejagt und gesammelt, die Anzahl der Menschen war begrenzt durch das
vorhandene Angebot an Lebensmitteln. War ein Landstrich abgeweidet, zog
man weiter – von einer Nische zur andern. Manchmal geschah eine
Katastrophe, bei der eine ganze Population zugrunde gehen mochte. Aber
die war unvorhersehbar, man konnte nicht vorsorgen.
 Wie
auch? Viel Vorrat konnten sie auf ihren Wanderungen nicht tragen; und
wie sollten sie ihn haltbar machen? Gelegentliche Überschüsse mußten
vergeudet werden, im Fest. Der Überfluß war ebenso unvorhersehbar wie
die Not. Denn beide waren Ausnahmen, die die Regel bestätigen: das
ökologische Gleichgewicht. Unsere
Vorfahren darbten nicht stets am Rande des Untergangs. Sonst hätten sie
sich nicht von Ostafrika aus über die ganze Welt verbreiten können. Und
nicht in steter Sorge: sonst hätten sie kaum die Muße gehabt, uns jene
prachtvollen Zeugnisse ihres künstlerischen Genies zu hinterlassen, die
wir in den Höhlen der Dordogne und der kantabrischen Berge.
Wie
auch? Viel Vorrat konnten sie auf ihren Wanderungen nicht tragen; und
wie sollten sie ihn haltbar machen? Gelegentliche Überschüsse mußten
vergeudet werden, im Fest. Der Überfluß war ebenso unvorhersehbar wie
die Not. Denn beide waren Ausnahmen, die die Regel bestätigen: das
ökologische Gleichgewicht. Unsere
Vorfahren darbten nicht stets am Rande des Untergangs. Sonst hätten sie
sich nicht von Ostafrika aus über die ganze Welt verbreiten können. Und
nicht in steter Sorge: sonst hätten sie kaum die Muße gehabt, uns jene
prachtvollen Zeugnisse ihres künstlerischen Genies zu hinterlassen, die
wir in den Höhlen der Dordogne und der kantabrischen Berge.
Bleiben oder
wandern, das war die einzige Alternative. Mehr gab es nicht vorzusehen.
Mit dem Übergang zum Getreidebau und der Seßhaftigkeit änderte sich das.
Das war die „neolithische Revolution“, nach der Erfindung des
aufrechten Ganges die zweite dramatische, nämlich selbstgemachte Wendung
in unserer Gattungsgeschichte. Sie begann vor etwa zwölftausend Jahren
bei Jericho im Tal des Jordan. Von nun an gab es einen regelmäßigen
Überschuß – auf den man zählen konnte und mit dem man rechnen mußte.
Denn dieser
Überschuß war haltbar: Man kann ihn akkumulieren. Wozu er dienen soll,
muß und darf nicht der unmittelbaren Notdurft überlassen bleiben.
Getreide ist seiner natürlichen Beschaffenheit nach nicht nur haltbar,
sondern vor allem auch unendlich teilbar. Würde er sogleich verteilt,
wird er verzehrt und vergeudet. Es muß aber ein Vorrat angelegt werden
für die Zeit bis zur neuen Ernte. Doch was „notwendig“ ist, läßt sich
nun nicht mehr mit bloßem Augenschein ermessen. Man muß es errechnen.
Aus der Sorge wird Vorsorge. Man braucht einen Plan.
Der Plan
Um zu planen, muß
man messen. Muß man kombinieren und schlußfolgern. Logik ist die
Ökonomik des Vorstellens. Die Welt ‚ist’ nur, wenn sie gedacht wird.
Aber eine logisch konstruierte Welt ist beinahe keine mehr: sondern eine
selbstgezimmerte Umwelt mit mondänem Blendgiebel. Die Welt ist vor
allem offener Raum. Jene planvolle Unter-Welt oder Über-Nische ist – vor
allem andern – knappe Zeit. Denn ab jetzt regiert die Arbeit.
Die grundsätzliche
Möglichkeit der Ertragssteigerung setzt das natürliche Gleichgewicht
zwischen Nahrungsangebot und Bevölkerungsentwicklung außer Kraft. Die
Population kann jetzt ständig wachsen – und so wird die Überbevölkerung
endemisch. Jede Mißernte und jede äußere Störung macht deutlich, welcher
Teil des Volks „weniger wichtig“ und zur Not entbehrlich ist. Seit die
Entscheidung über den Plan von einem Volksteil monopolisiert wird, gibt
es eine überschüssige Bevölkerung – der andre Teil! Der Übergang zum
Ackerbau ist der Anfang der Politik und der Beginn der
Klassengesellschaft. Der Kampf um die Verteilung wird zum Angelpunkt der
Condition humaine. Aus der Wirtschaft entspringt die Sorge. Durch das Wirtschaften wird Notdurft zum ‚Gattungswesen’ des Menschen.
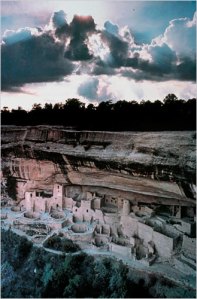 Tätige Sorge ist
Arbeit. Sie ist das universelle Mittel, die Notdurft zu befriedigen.
Nicht Risiko, sondern Befriedigung heißt seither das Entwicklungsgesetz.
Was jedermanns und jederfraus
Eigen- stes ist: ihr Be- dürfnis, wird durch Zirkulation zum Spezifikum
von Allen genera- lisiert. Zur Not- durft-an-sich tritt
Befriedigung-an-sich: der „Wert“ der Nationalökonomen. Was eine Sache
wert ist, mißt sich daran, wieviel Arbeit es braucht, um sie zu
beschaffen. An diesem Maßstab kann alles miteinander verglichen und
gegeneinander getauscht werden. Die Verteilung der Arbeit auf die
Bedürfnisse durch den Austausch von Waren wird zum Normalzustand des
Homo sapiens. Ihr letztes Wort war die Große Industrie des 19. und 20.
Jahrhunderts.
Tätige Sorge ist
Arbeit. Sie ist das universelle Mittel, die Notdurft zu befriedigen.
Nicht Risiko, sondern Befriedigung heißt seither das Entwicklungsgesetz.
Was jedermanns und jederfraus
Eigen- stes ist: ihr Be- dürfnis, wird durch Zirkulation zum Spezifikum
von Allen genera- lisiert. Zur Not- durft-an-sich tritt
Befriedigung-an-sich: der „Wert“ der Nationalökonomen. Was eine Sache
wert ist, mißt sich daran, wieviel Arbeit es braucht, um sie zu
beschaffen. An diesem Maßstab kann alles miteinander verglichen und
gegeneinander getauscht werden. Die Verteilung der Arbeit auf die
Bedürfnisse durch den Austausch von Waren wird zum Normalzustand des
Homo sapiens. Ihr letztes Wort war die Große Industrie des 19. und 20.
Jahrhunderts.
Ausgezeichneter Ort der Sorge und Vorsorge ist der Haushalt – gr. oikos, lat. familia. Er ist aber eben eine Nische höherer Ordnung, eine, die Kraft und Ingenium
erheischt, denn sie will eingerichtet und ausgebaut sein. Und das
Gleichgewicht in ihrem Innern ist nicht ökologisch vorgegeben, sondern
wird erst durch Politik jedesmal neu austariert. Im Großen wie im
Kleinen: „Die Familie ist die Keimzelle der Gesellschaft“ heißt nichts
anderes als daß sich ‚die Gesellschaft’ selber als Ein Großer Haushalt
vorkommt. Denn Notdurft ist ihre Klammer, Einsicht in die Notwendigkeit
lautet ihre Moral. Und Politische Ökonomie heißt ihre Gesetzestafel. Aus
der Welt ist der Mensch in eine Nische zurückgekehrt, die er sich
selbst gemauert hat.
Homo faber
Der Mann ist Arbeitnehmer und Soldat.
Gottfried Benn
Des Weibes ewige Politik ist die Eroberung des Mannes.
Oswald Spengler
Man muß sich Sisyphus glücklich vorstellen.
Albert Camus
Daß
es der Gattung Homo überhaupt gelang, die Energien der männlichen
Population für Ernährung und Aufzucht der Nachkommen zu erschließen, war
ein großer Selektionsvorsprung gegenüber konkurrierenden Arten. Indem
dabei die spezifisch männliche Tätigkeit – die Jagd – zugleich die
elementare Lebensweise prägte – die Vaganz -, wurde die Familie Homo zur
gewissermaßen männlichsten unter den Lebewesen.
Mit der Seßhaftigkeit trat der weibliche Arbeitstyp, Sammeln und Hackbau, in den Vordergrund: Das lateinische cultura bedeutet ursprünglich Ackerbau und kommt von collere,
sammeln. Der Ackerbau ist – anders als der Hackbau, aber wie die Jagd –
körperliche Schwerarbeit. Er wird Männersache. Er verlangt aber auch –
wie der Hackbau, anders als die Jagd – Gleichmut und Ausdauer. Der Mann
richtet sich nach der Frau.
 Symbolisch
ist die Zähmung des Feuers. Zunächst ist das Feuer, quer durch die
Kulturen, ein Symbol des Männlichen, es steht für seine Kraft und
Gefährlichkeit. Aber gerade darum gehört es in sichere Hände. Der Mann
entzündet es, aber die Frau hat es in ihrer Hut. Auch das ändert sich
mit der Seßhaftigkeit. Aus der Nutzbarmachung des Feuers entstehen die
ersten Berufe – Ofensetzer, Metallurge, Schmied; Männer, die an den
heimischen Herd gebunden sind. Das Schmelzen von Kupfererz dürfte als
Nebenprodukt beim Glasieren von Keramik entdeckt worden sein. Neugier,
Spieltrieb und Erfindungsgeist – dienstbar gemacht für den Innenausbau
der Nische. Der Mann am Herd ist das Sinnbild der kommenden
Jahrtausende: Homo faber. Er symbolisiert die Einvernahme des Mutwillens durch die Sorge.
Symbolisch
ist die Zähmung des Feuers. Zunächst ist das Feuer, quer durch die
Kulturen, ein Symbol des Männlichen, es steht für seine Kraft und
Gefährlichkeit. Aber gerade darum gehört es in sichere Hände. Der Mann
entzündet es, aber die Frau hat es in ihrer Hut. Auch das ändert sich
mit der Seßhaftigkeit. Aus der Nutzbarmachung des Feuers entstehen die
ersten Berufe – Ofensetzer, Metallurge, Schmied; Männer, die an den
heimischen Herd gebunden sind. Das Schmelzen von Kupfererz dürfte als
Nebenprodukt beim Glasieren von Keramik entdeckt worden sein. Neugier,
Spieltrieb und Erfindungsgeist – dienstbar gemacht für den Innenausbau
der Nische. Der Mann am Herd ist das Sinnbild der kommenden
Jahrtausende: Homo faber. Er symbolisiert die Einvernahme des Mutwillens durch die Sorge.
Krieg und Klassenspaltung
Doch Schmiede
waren nur die wenigsten. Alle andern waren Bauern und taten mehr oder
weniger dasselbe – Ackerbau und häusliches Handwerk. Bis sich die
Gesellschaft in Herren und Knechte schied. Dazwischen liegt die
Erfindung des Krieges. Auch die Wanderer kannten neben der Jagd schon
den Raub. Doch erst die Bauern führen Krieg – seit sie einen Boden zu
verteidigen haben: ihre Nische, den Haushalt, den Herd.[1]
Und den Krieg führen sie typischerweise gegen die Nomadenstämme – jene
Volksgruppen, die die Seßhaftigkeit hochmütig verschmähten und jagend
hinter den wilden Tieren herzogen, bis sie zu deren Hirten wurden. Das
sind die Herrenvölker – selbst Jahwe zog den Hirten Abel dem Bauern Kain vor.
 Die Herren verschmähen die behäbige Lebensart der Bauern, aber ihre Ernten verschmähen sie nicht, und
regelmäßig erscheinen sie unter den Mauern, um zu plündern – von
Jericho bis Samarkand und Timbuktu. Dem Ansturm der Herren von außen
stellen sich die Herren im Innern entgegen. Aus der Kaste
spezialisierter Krieger bildet sich, im Bündnis mit den Priesterinnen
der Großen Mutter, eine herrschende Klasse. Das sind Herren im Dienste
der Frauen. Sie herrschen, aber sozusagen nur “in Kommission”. (Das ist
der wahre Kern von Bachofens ‚Matriarchat’.)
Die Herren verschmähen die behäbige Lebensart der Bauern, aber ihre Ernten verschmähen sie nicht, und
regelmäßig erscheinen sie unter den Mauern, um zu plündern – von
Jericho bis Samarkand und Timbuktu. Dem Ansturm der Herren von außen
stellen sich die Herren im Innern entgegen. Aus der Kaste
spezialisierter Krieger bildet sich, im Bündnis mit den Priesterinnen
der Großen Mutter, eine herrschende Klasse. Das sind Herren im Dienste
der Frauen. Sie herrschen, aber sozusagen nur “in Kommission”. (Das ist
der wahre Kern von Bachofens ‚Matriarchat’.)
Und
die große Masse sinkt herab zu Fronbauern am Nil, zu Staatssklaven an
Euphrat und Tigris. Wo ist das mutwillige Element geblieben, das die
Bildung der Gattung Homo einmal hervorgerufen hatte, wo die Freiheit? In
der Arbeitsgesellschaft sind die Gelegenheiten, nein zu sagen, ungleich
verteilt. Wählen kann der Herr, aber der muß nicht arbeiten. Das Los
des werktätigen Knechts ist Sorge. Der wählt nicht frei zwischen den
Möglichkeiten, sondern wägt ab zwischen mehr oder weniger Notwendigem.
Das Gefühl, gezwungen zu sein, wird er nicht los.
Und
wenn er glaubt, anderswo besser dran zu sein, halten ihn Weib und
Kinder an der Scholle fest – wenn er eine eigne Scholle hat! Dann bleibt
ihm die Hoffnung, durch Mehrarbeit und vorsorgliche Planung einen
Überschuß wenn nicht heute, dann vielleicht morgen zu erzielen und auch
ein Stücklein Freiheit zu ergattern. Und so jedes Jahr aufs neu. Er ist
gar kein faber, sondern ein Haushälter: Homo oeconomicus. Der
verhäuslichte, mit Konrad Lorenz zu reden: der verhausschweinte Mann.
Der Unternehmer
 Die
Vollendung der Arbeitsgesellschaft zur großen Industrie war kein
Naturvorgang. Es war ein dramatischer Prozeß mit Brüchen und Sprüngen,
durch die jeweils das männliche Element wieder freigelassen wird und
sich zu neuen Typen stilisiert. Immer nur eine kleine Vorhut aus der
großen Masse der Homini oeconomici, aber ein Ferment, das neue
Wirklichkeiten schafft. So tritt während der germanischen Wanderungen
aus den Trümmern der Sklavenhaltergesellschaft der Fahrende Ritter.Aber
schon bald setzt er sich auf der Scholle fest und hält Hof. Die
„Idiotie des Landlebens“ (Marx) holt ihn ein. Der Mutwille, das
Handeln fristet ein Nischendasein – beim Krämer zwischen den
Stadtmauern, beim reisenden Kaufmann zwischen den Städten.
Damit
er in Gestalt des Unternehmers noch einmal ganz nach vorn treten
konnte, brauchte es nicht weniger als die industrielle Revolution – die
zugleich die breite Masse der Ackerleute aus ihren Nischen jagt und ins
Elend der Lohnarbeit „frei setzt“. Im selben Maß, wie sich dann der
Proletarier zum Angestellten zurichtet, verhäuslicht der Unternehmer zum
Manager – Funktionär und Verwalter des Kapitals. „Die Sicherheit ist der höchste soziale Begriff der bürgerlichen Gesellschaft“,
ahnte Marx. Die ehedem Weite Welt als Bedürfnisbefriedigungs- anstalt,
die Große Industrie ganz ohne Unternehmer, der Große Plan ganz ohne
Freiheit: das war dann der realexistierende Wie-hieß-er-doch-gleich, die
feudalbürokratische Hyper-Nische. Sie ist untergegangen wie Ninive und
Babylon.
Die
Vollendung der Arbeitsgesellschaft zur großen Industrie war kein
Naturvorgang. Es war ein dramatischer Prozeß mit Brüchen und Sprüngen,
durch die jeweils das männliche Element wieder freigelassen wird und
sich zu neuen Typen stilisiert. Immer nur eine kleine Vorhut aus der
großen Masse der Homini oeconomici, aber ein Ferment, das neue
Wirklichkeiten schafft. So tritt während der germanischen Wanderungen
aus den Trümmern der Sklavenhaltergesellschaft der Fahrende Ritter.Aber
schon bald setzt er sich auf der Scholle fest und hält Hof. Die
„Idiotie des Landlebens“ (Marx) holt ihn ein. Der Mutwille, das
Handeln fristet ein Nischendasein – beim Krämer zwischen den
Stadtmauern, beim reisenden Kaufmann zwischen den Städten.
Damit
er in Gestalt des Unternehmers noch einmal ganz nach vorn treten
konnte, brauchte es nicht weniger als die industrielle Revolution – die
zugleich die breite Masse der Ackerleute aus ihren Nischen jagt und ins
Elend der Lohnarbeit „frei setzt“. Im selben Maß, wie sich dann der
Proletarier zum Angestellten zurichtet, verhäuslicht der Unternehmer zum
Manager – Funktionär und Verwalter des Kapitals. „Die Sicherheit ist der höchste soziale Begriff der bürgerlichen Gesellschaft“,
ahnte Marx. Die ehedem Weite Welt als Bedürfnisbefriedigungs- anstalt,
die Große Industrie ganz ohne Unternehmer, der Große Plan ganz ohne
Freiheit: das war dann der realexistierende Wie-hieß-er-doch-gleich, die
feudalbürokratische Hyper-Nische. Sie ist untergegangen wie Ninive und
Babylon.
 Welche die männlichsten Männer sind, haben durch Zuchtwahl noch immer die Frauen bestimmt, und der domestizierte Mann läßt sich’s gefallen. Der
Mutwille konnte durch all die Jahrtausende nur an den Rändern
überleben. Als Kondottiere und Konquistador, als Seefahrer, Pirat und
Entdecker; als Erfinder, Spinner und Philosoph, und schließlich als
Künstler und Revolutionär. All diese Ausreißer und Grenzgänger der
Arbeitsgesellschaft müßten sich rechtfertigen, und das könnten sie nur
durch den Erfolg; der ist aber den wenigsten vergönnt.
Welche die männlichsten Männer sind, haben durch Zuchtwahl noch immer die Frauen bestimmt, und der domestizierte Mann läßt sich’s gefallen. Der
Mutwille konnte durch all die Jahrtausende nur an den Rändern
überleben. Als Kondottiere und Konquistador, als Seefahrer, Pirat und
Entdecker; als Erfinder, Spinner und Philosoph, und schließlich als
Künstler und Revolutionär. All diese Ausreißer und Grenzgänger der
Arbeitsgesellschaft müßten sich rechtfertigen, und das könnten sie nur
durch den Erfolg; der ist aber den wenigsten vergönnt.
[1]
Die antiken Kriegsgötter waren ursprünglich Ackergötter; so Ares-Mars,
der – als Fruchtbarkeitsgott – später mit Eros-Amor in Beziehung
gebracht wurde.
<<<zurück Erst wenn der Kopf oben ist, gehen wir aufrecht.
 Corbis
Corbis


+Frauen+(Unten)verma_large.jpg)

.+Hanser+2014.jpg)