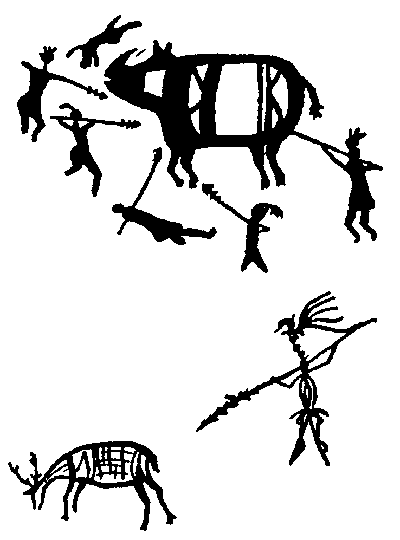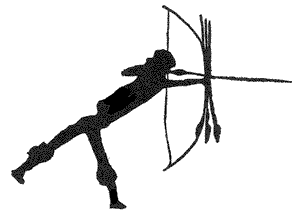![]()
Pressemeldung
Universitätsklinikum Tübingen,
Eberhard-Karls-Universität
18. 5. 2010
Studie 1 – Bei einer Aufgabe zur sozialen Wahrnehmung werden Frauen von einer negativen Aussage stärker negativ beeinflusst als Männer
Studie 2 – Frauen und Männer unterscheiden sich deutlich in der neuronalen Verarbeitung und Wahrnehmung sozialer Signale
Wissenschaftler am Universitätsklinikum Tübingen haben Geschlechtsunterschiede in der sozialen Wahrnehmung untersucht. Dabei zeigte sich, dass die Leistung von Frauen dramatisch von negativen Stereotypen (vereinfacht als „klischeehafte Verallgemeinerungen“ bezeichnet) beeinflusst wird. Erstmals konnte damit die Wirkung stereotyper Aussagen auf Geschlechtsunterschiede in sozialer Kognition nachgewiesen werden (1).
In einer zweiten Studie (2) konnte die Forschergruppe einen weiteren geschlechtsspezifischen Unterschied zeigen. Bei Frauen wird eine Gehirn-Region zur Bewertung von sozialen Wahrnehmungsinhalten deutlich früher als bei Männern aktiviert. Frauen erkennen somit sozial relevante Inhalte früher und benötigen daher weniger entsprechende Informationen als Männer, um soziale Situationen bewerten zu können. Demgegenüber konnten bei den für soziale Wahrnehmung selbst zuständigen Gehirnregionen keine Unterschiede festgestellt werden.
(1)
Stereotype Aussagen verursachen Geschlechtsunterschiede in Sozialer Kognition
Insgesamt 83 weibliche und männliche Medizinstudierende im Alter von 20 bis 36 Jahren absolvierten einzeln den Bilder-ordnen Test (ein Teil des Wechsler Intelligenztests für Erwachsene – WIE). Bei dieser Aufgabe müssen die Probanden eine Reihe von Bildern, die die Einzelbilder eines sozialen Ereignisses darstellen, in der richtigen Reihenfolge anordnen. Es wird angenommen, dass eine gute Leistung bei einer solchen Aufgabe ein Verständnis der mentalen Zustände der abgebildeten Personen erfordert.
Um die Aufgabe erfolgreich lösen zu können, müssen die Probanden den Kern der Handlung erfassen, welches oft nur durch das Verständnis von Absichten und Einstellungen der bei dem jeweiligen Ereignis abgebildeten Personen ermöglicht wird. Frühere Studien hatten gezeigt, dass bei dieser Aufgabe keine geschlechtsspezifischen Unterschiede auftreten. In der aktuellen Studie bekam eine Gruppe vor dem Versuch die manipulierte Information, dass Frauen bei diesem Test generell besser abschneiden, während die andere Gruppe erfuhr, dass Männer bessere Ergebnisse erzielen.
Die Ergebnisse zeigen, dass der Einsatz manipulierter stereotyper Aussagen geschlechtsspezifische Effekte auslösen kann. Eine positive Aussage verbessert das Abschneiden bei einer Aufgabe zur sozialen Wahrnehmung, während eine negative Information zu einer schlechteren Leistung führt. Dieser Effekt ist bei Frauen stärker ausgeprägt. Dagegen lassen sich Männer durch negative Informationen nur wenig beeinflussen. Die Ergebnisse lassen vermuten, dass Frauen auch in anderen Bereichen des alltäglichen Lebens durch klischeehafte negative Vorurteile, beispielweise im Hinblick auf Einparken, Durchsetzungsfähigkeit oder mathematisches Denken stärker beeinflusst werden als Männer.
—————————————
…oder beispielsweise im Hinblick auf männliche Dominanz, Aggressivität von Testosteron, ungezogene Jungens, patriarchale Strukturen… JE
—————————————
(2)
Geschlechtsspezifische Unterschiede in der Gehirnaktivität bei der sozialen Wahrnehmung
In dieser Studie wurden gesunde Frauen und Männer im MEG (Magnetoenzephalogramm) daraufhin untersucht, ob die Gehirnregionen, die für soziale Wahrnehmung zuständig sind – vor allem der rechte temporale Kortex – unterschiedlich reagieren. Man benutzt dazu eine Versuchsanordnung, bei der den Versuchspersonen geometrischen Figuren gezeigt werden, deren Interaktion von den Probanden als „sozial“ oder „nicht sozial“ eingeschätzt werden. Die auf soziale Interaktionen ansprechenden Gehirnregionen sind bei Männern und Frauen identisch. Auffallend war, dass die entsprechenden, für soziale Interaktion zuständigen Gehirnregionen bei Frauen früher reagierten. Interessanterweise deuten die Ergebnisse auf eine schnellere neuronale Verarbeitung sozialer Signale bei Frauen hin. Frauen benötigen daher weniger Informationen um soziale Interaktionen zu erkennen.
———————————————-
Oder sagen wir mal: Frauen sind schneller dabei, sich in Diskussionen der Beziehungsebene zuzuwenden, als sich für die Objektebene zu interessieren; darum sind sie, wie man hört, auch anfälliger für Klatsch und soziale Vorurteile. JE
_______________________________
Nota. - Die VerfasserIn dieser Pressemeldung heißt Dr. Ellen Katz, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Universitätsklinikum Tübingen. Damit der Leser auch versteht, was gemeint ist, hat sie ihm mit ihren Formulierungen dankenswerter Weise gleich ein anschauliches Beispiel mitgeliefert.
JE






(1).jpg)