aus süddeutsche.de,
Von Sonja Zekri
Zu den finsteren Kapiteln der Medizingeschichte gehören zweifellos die Menschenexperi-mente von Leo L. Stanley. In den Zwanzigerjahren war Stanley, ein bekennender Eugeniker, Gefängnisarzt im berüchtigten kalifornischen Gefängnis San Quentin und führte die Aufsicht über mehr als 10 000 Hodenimplantationen - mit menschlichem Gewebe, etwa von hingerich-teten Häftlingen, außerdem mit Testikeln von Ziegen, Widdern oder Hirschen. Mit seiner Methode erziele er wunderbare Erfolge, schwärmte Stanley, er habe ein breites Spektrum an Leiden von Parkinson bis Paranoia und natürlich Impotenz lindern können.
Ein Kollege Stanleys injizierte sich selbst Testikelextrakte von Meerschweinchen, andere planten in Afrika eine Schimpansenzucht, um aus den Geschlechtsdrüsen der Primaten das "Elixier ewiger Jugend" zu gewinnen. Ein Effekt von Rebecca Jordan-Youngs und Katrina Karkazis' Buch "Testosteron" ist zweifellos der Eindruck, dass Wissenschaftler im Namen des Menschheitswohls oft ziemlichen Unfug gemacht haben. Nur war es beim Testosteron beson-ders folgenschwerer Unsinn.
Bis heute wird Testosteron oder einfach nur "T", wie Jordan-Young und Karkazis es etwas übertrieben lässig nennen, zur Erklärung von vielem herangezogen, Polizeigewalt, Börsencrashs und den Mangel von Frauen in Führungspositionen etwa. In 100 Jahren des Gespräches über Testosteron, so die Autorinnen, seien fast hermetische Narrative entstanden, ja, ein regelrechter "Mythos", dessen Geschichte "kaum je aktualisiert wurde". Diesem "T-Talk", der "T-Folklore", wollen Jordan-Young und Karkazis, Medizinsoziologin die eine, Bioethikerin die andere, eine "nicht-autorisierte Biografie" gegenüberstellen. Es hätte des Untertitels - "Warum ein Hormon nicht als Ausrede taugt" - nicht bedurft, um zu ahnen: Sie haben politische Hintergedanken.
Konsequenterweise
haben die Autorinnen auch weniger einen systematischen
Forschungsüberblick im Sinn, als eine Analyse des Wechselspiels von
Forschung und Gesellschaft, also vor allem der USA. Sie dekonstruieren
den historischen Kontext einiger Studien, durchleuchten fragwürdige
Versuchsanordnungen oder die rassistisch beeinflusste Auswahl von
Probandengruppen. Dem Gemeinwissen stellen sie aktuelle
Forschungsansätze entgegen, die ein paar Fragen an vermeintliche
Selbstverständlichkeiten formulieren. Dass Testosteron beispielsweise
noch immer einzig als "männliches Sexualhormon" beschrieben wird, sei in
dieser Verengung nicht nur falsch, schließlich werde es auch in
Eierstöcken produziert. Doch Testosteron werde herangezogen, um eine
Kategorie biologisch zu begründen, die in Wahrheit ein kulturelles
Konstrukt ist: das Geschlecht.
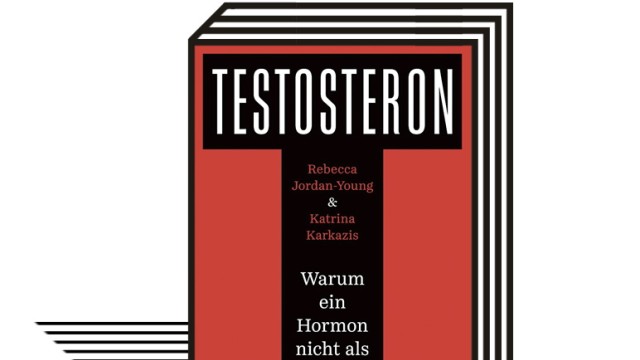
Rebecca Jordan-Youngs, Katrina Karkazis: Testosteron - Warum ein Hormon nicht als Ausrede taugt. Hanser Verlag, München 2020. 384 Seiten, 25 Euro.
Im Falle der intersexuellen südafrikanischen Leichtathletin Caster Semenya hatte das tragische Folgen: Wenn sie auf ihrer stärksten Distanz - den 800 Metern - starten will, muss sie ihren Testosteronwert mit Medikamenten senken. Doch auch Machtverhältnisse werden - testosteronbedingt - zur Frage der Hormone. Solange es als ausgemacht gilt, dass Börsenmanager und Silicon-Valley-Milliardäre hohe Testosteronwerte aufweisen, stellt sich die Frage nach der Chancengleichheit gar nicht. Erfolg und Einfluss hängen dann ab von der biologischen Grundausstattung, nicht von gesellschaftlichen Verhältnissen, die sich beeinflussen und verändern lassen. Die Biologie nimmt der Ungerechtigkeit das Skandalöse und macht sie zum individuellen Schicksal.
In den USA, wo die Selbstoptimierung zur Nationalkultur gehört, führt dies zu bizarren Blüten. Die Sozialpsychologin Amy Cuddy versprach Frauen eine Steigerung ihres Ansehens durch eine Imponierpose: Schon zwei Minuten als breitbeinige Wonder Woman lasse den Testosteron-Spiegel steigen und damit auch die Risikobereitschaft. Zwar zerlegten Forscher diese Theorie, aber längst war nicht nur eine Debatte, sondern eine regelrechte kleine Power-Posing-Industrie entstanden.
"Testosteron" ist kein einfaches Lesevergnügen. Laien werden nicht allen Details folgen können, immer wieder verlieren sich die Autorinnen auf Nebengleisen. Die deutsche Übersetzung hilft auch wenig, denn sie enthält nicht nur jede Menge Anglizismen, sondern auch Nonsens, wie den Verweis auf "methodische Entscheidungen, die in einem Zusammenhang mit den allgemeinen Ideen über das, was Testosteron ist und tut, zusammenhängen."
Dennoch muss man die Lektüre dringend empfehlen. Wenn sich eines Tages die Wissenschaftshistoriker über die epidemiologische Forschung unserer Zeit beugen - und das werden sie -, werden uns die Ergebnisse weniger erstaunen.








